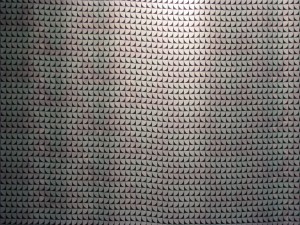Im 19. Jahrhundert hatte sich ein kritischer Kopf namens Karl Marx mit der Bedeutung der Arbeit für den Menschen befasst. In deutlicher Klarheit schrieb er: „Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der unorganischen Natur ist die Bewährung des Menschen als eines bewußten Gattungswesens …“ Diesen noch engen Begriff von Arbeit begann Eberhard Braun, ein Schüler des Philosophen Ernst Bloch, mehr als hundert Jahre später in seinen „Grundrissen einer besseren Welt“ zu hinterfragen: „Was heißt hier Arbeit?“ Wie hängen materielle Bearbeitung der Natur und Bewußtseinsbildung zusammen?
Braun geht über Marx hinaus und sieht in der Arbeit die „Produktion eines bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisses“. Braun sucht die gesellschaftliche Dimension, wenn er argumentiert: „Arbeit ist nicht nur Stoffwechsel, Aneignung der äußeren Natur, sie stellt nicht nur einzelne lebensnotwendige Produkte her; insofern sie dies tut, produziert sie zugleich auch ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis, einen bestimmten historischen Lebenszusammenhang …“
Dieser Kernsatz Braun’schen Denkens lässt sich nun auf eine aktuelle Transformation des Charakters von Arbeit übertragen: Welche Lebenszusammenhänge, welche gesellschaftlichen Verkehrsformen wird die fortschreitende Dematerialisierung und Virtualisierung eines wachsenden Teiles der Erwerbsarbeit nach sich ziehen? Wie wirkt sich die zunehmende Entgegenständlichung von Arbeit auf die Identitätsbildung und die soziale Realität des Menschen heute aus?
Alte Bewußtseinsschichten mehrerer Generationen wirken in den heutigen arbeitenden Generationen fort. Das Herstellen eines materiellen Gegenstandes gibt dem schaffenden Individuum Genugtuung und Selbstbewußtsein. Nun aber in Zeiten von „Neuen Infrastrukturen der Arbeit“, von „Industrie 4.0“ und von „Cyber-Physical Systems“ wird die Genugtuung und das Selbstbewußtsein mehr und mehr aus virtuellen Arbeitsumgebungen erwachsen müssen. Die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ beginnen, schrittweise auf dem Zusammenwachsen – auf der Konvergenz – von Materiellem und Virtuellem zu basieren. Die Produktionsformen sind im Umbruch. Aus der alten Gemeinschaft wird eine neue Sozialität entstehen. Atomisiert oder community-orientiert?
In diesen Zeiten der Ungleichzeitigkeiten wird das Denken Eberhard Brauns, seine politische Philosophie der Hoffnung, wieder aktuell.