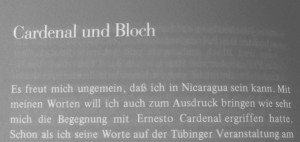Helmut Fahrenbach (Foto: © Welf Schröter)
Für eine „kommunikative Vernunft als weltpolitisch und interkulturell notwendige Denkform“ setzt sich der Tübinger Philosoph Helmut Fahrenbach mit seinem Werk „Philosophie ‒ Politik ‒ Sozialismus. Ein prekäres Verhältnis in Deutschland“ ein.
Seinem Plädoyer für „Frieden, Ernährung, Ökologie, ökonomisch-soziale Entwicklung zu menschenwürdigen Lebensverhältnissen unter Anerkennung und Sicherung der Menschenrechte im Sinne möglicher Freiheit, Gleichheit und Solidarität“ legt er seine kritische Lesart der „Erbschaft der Philosophie des 20. Jahrhunderts“ zugrunde.
Dieses Werk stellt nicht nur eine hilfreiche Orientierung in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit im Umgang mit Themen der Philosophie dar. Es ist zugleich ein unterstützendes Lehrbuch für junge Menschen, die Philosophie studieren wollen. Der Autor gehört zu den markantesten Philosophen in der Nachkriegsgeschichte der Universität Tübingen.
Wenige Tage vor seinem 88. Geburtstag würdigt Helmut Fahrenbach in seinem 488 Seiten umfassenden Buch damit die Chance der Philosophie, Erbschaft und Baustein für eine mündige Gesellschaft zu sein. In scharfer Abgrenzung vom Sowjetkommunismus und in deutlicher Kritik rechtskonservativer Philosophien beschreibt der Autor den Diskurs um den Emanzipationsgehalt der Philosophie
im 20. Jahrhundert.
Der spannungs- und konfliktreich ‚vernetzten‘ Weltlage kann nur ein Denken und Handeln gerecht werden, das die Disparitäten und Spannungen zwischen Einheit und Differenz, Allgemeinem und Besonderem, Macht und Abhängigkeit durch eine die Verbindung und Verschiedenheit in der gegenwärtigen Welt zugleich wahrende und vermittelnde Sicht theoretisch zu erfassen und praktisch zum Abbau bzw. Ausgleich zu bringen versucht. Zur Klärung der damit gestellten Aufgaben ist auch Philosophie vonnöten, freilich nicht irgendeine, sondern eine Philosophie kommunikativer Vernunft, für die das dialektische Verhältnis von Einheit und Vielfalt, Allgemeinem und Besonderem eine zentrale Reflexionsaufgabe darstellt, und dies insbesondere im Hinblick auf die Ermöglichung der Verständigungs- und Kooperationsprozesse, die für die Entwicklung und den Bestand einer humanen, ausgleichenden Welteinheit in einer sozio-kulturell pluralistisch und politisch-ökonomisch disparat verflochtenen Weltgesellschaft notwendig sind. (Helmut Fahrenbach)
Helmut Fahrenbach greift in der Betonung des emanzipatorisch ausgerichteten Bewusstseins auf wesentliche Gedanken des Philosophen Ernst Bloch zurück.
Ernst Bloch hat ja – als einer der wenigen unter den marxistischen Philosophen, neben Agnes Heller, aber auch Herbert Marcuse – die normativen (naturrechtlichen und ethischen) Postulate und Leitideen auch des marxistischen Sozialismus nicht verdrängt, sondern herausgestellt. Und er hat die damit verbundenen wirkungsgeschichtlichen Bezüge zu den bürgerlichen Revolutions- und Emanzipationsidealen Freiheit, Gleichheit, Solidarität nicht als ‚bürgerliche Ideologie‘ abgetan oder in einer „Dialektik der Aufklärung“ aufgelöst, sondern sie als „sozialistisches Erbe“ in Anspruch genommen, das freilich nicht nur die idealen Forderungen (noch dazu in einer liberalistischen Formalisierung und Engführung) wiederholt, sondern – im Sinne sozialistischer Theorie und Praxis – auf die realen gesellschaftlich-ökonomischen Voraussetzungen ihrer konkreten Ermöglichung und Realisierung dringt. (Helmut Fahrenbach)
Helmut Fahrenbach gelingt mit diesem Band nicht nur eine Ermutigung für die Verteidigung einer freiheitlichen und demokratischen Republik. „Der Autor nutzt die Kraft des Wortes für die Stärkung des Humanum, für die Humanisierung des Menschen“, unterstreicht der Verlag. „Gerade in einer Zeit der Verunsicherung und vorsätzlicher Demagogie gibt Helmut Fahrenbach den Leserinnen und Lesern ein verlässliches Instrumentarium an die Hand, das zum eigenständigen Denken anregt.“
Buchangaben: Helmut Fahrenbach: Philosophie – Politik – Sozialismus. Ein prekäres Verhältnis in Deutschland. 2016, 488 Seiten, br., 39,00 €, ISBN 978-3-89376-158-6.