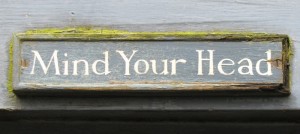Mancher Jahrestag lädt ein zu Erinnerungen und zu differenzierendem Nachdenken. Vor 25 Jahren starb am 12. November 1989 die aus dem Baskenland stammende mehr als neunzigjährige Franco-Gegnerin und Widerstandskämpferin Dolores Ibárruri. Bekannt wurde sie unter ihrem politischen Namen „La Pasionaria“. Sie gehörte zu den führenden Persönlichkeiten des spanischen Kommunismus. Nach der Niederlage der Republik gegen die faschistische Machtübernahme floh sie in die Sowjetunion.
„La Pasionaria“ war Kommunistin, ein Leitbild für die spanischen Frauen, ein Symbol für die „Internationalen Brigaden“ und zugleich eine loyale Interpretin des Stalinismus. Sie galt als Symbol für die antifaschistische Befreiung und war zugleich Sprecherin eines parteidiktatorischen Gesellschaftsmodells.
„La Pasionaria“ mit ihrem Ausspruch „No pasarán“ („Sie werden nicht durchkommen“) galt in ganz Europa als Sinnbild des Widerstandes gegen Hitler, gegen Franco und Mussolini. Auch die damals über dreißigjährige Karola Bloch war eine begeisterte Anhängerin der selbstbewussten Baskin und Spanierin: „So wie Rosa Luxemburg für mich auf der theoretischen Ebene ein großes Ideal war, so galt die ,Pasionaria‘ auf dem Gebiet der praktischen politischen Tätigkeit mir als Ideal“, erinnert sie sich im Gespräch im Jahr 1986 in ihrer Tübinger Wohnung.
Karola Bloch, die Architektin, Polin, Jüdin entschloss sich zu eigenen Formen des Widerstandes. Unter dem Decknamen „Olga“ reiste sie durch das Nazi-Reich von Paris nach Warschau, um polnischen Freunden geheime Kassiber des antifaschistischen Widerstandes zu überbringen. Trotz großer Angst und Gefährdung gelangen die Aktionen, wie sie in ihrer Autobiografie „Aus meinem Leben“ schrieb.
Doch anders als Dolores Ibárruri floh Karola Bloch vor der Gestapo ganz bewusst nicht in die Sowjetunion sondern in die USA. „Olga“ sah in der Sowjetunion die zentrale militärische Kraft gegen Hitler. Aber anders als die Journalistin der spanischen KP-Zeitung „Mundo Obrero“ stellte sich Karola Bloch gegen das politische System des Stalinismus. Karola Blochs Kommunismusverständnis widersprach der „Diktatur des Proletariats“ und der Parteilinie Moskaus. Während Dolores Ibárruri Menschen an den Geheimdienst Stalins verriet, half Karola Bloch jenen Kommunisten, die vor Stalin auf der Flucht waren. Erst im Jahr 1968 korrigierte sich Dolores Ibárruri und wandte sich gegen die „Breschnew-Doktrin“ und gegen die militärische Niederschlagung des „Prager Frühlings“ in der Tschechoslowakei. Da endlich waren sich beide Frauen wieder einig.
Zwei widerständige Frauen, zwei überzeugte Antifaschistinnen und dennoch zwei unterschiedliche, sich ausschließende Tagträume gesellschaftlicher Zukunft.