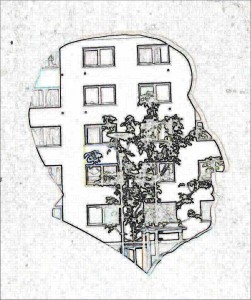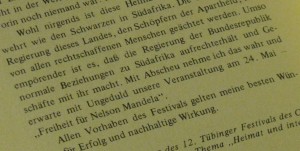Es waren öffentliche Plätze, auf denen gesellschaftliche Akteure den Tagtraum einer besseren Gesellschaft aufleben ließen. Es waren Orte, wo aus dem „Ich“ ein „Wir“ zu werden begann.
Es waren öffentliche Plätze, auf denen gesellschaftliche Akteure den Tagtraum einer besseren Gesellschaft aufleben ließen. Es waren Orte, wo aus dem „Ich“ ein „Wir“ zu werden begann.
Der Orte gab es mehrere. Sie standen für Aufbruch wie auch für Niederlagen. Sie zeigten aber die Kraft des Unabgegoltenen und Uneingelösten des zivilgesellschaftlichen Emanzipationsbestrebens.
Zu den Namen „Wenzelsplatz“ in Prag, „Augustusplatz“ in Leipzig, „Platz des Himmlischen Friedens“ in Peking, „Azadi-Platz“ in Teheran und „Tahrir-Platz“ in Kairo kam jetzt der „Maidan“ im ukrainischen Kiew. Auf letzterem verschmolzen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Würde mit dem Wunsch nach Demokratie, nach Verschränkungen von direkter und repräsentativer Demokratie.
Hans-Jürgen Krahl war es, der zutreffend bezüglich der Handelnden im „Prager Frühling“ feststellen musste, dass die Revolutionäre doch immer auch mit den Muttermalen desjenigen Systems versehen sind, gegen das sie ankämpfen. Im „Prager Frühling“ wollten sich die Akteure auf dem „Wenzelsplatz“ zu spät von der faktischen Dominanz der Rolle einer Partei lösen. Die Revolte auf dem „Tahrir-Platz“ suchte, alte Eliten zu beseitigen, hatte aber das Denken in autoritären Lösungsschritten geerbt. Nun der „Maidan“.
Er unterscheidet sich, da die Menschen sich an einem Traum orientierten, der von außen in Attraktivität zu leuchten begann. Es war das Bild von Europa, das ihnen vermittelt war. Dieses Bild von Demokratie, Rechtsstaat und Lebensqualität setzte ungeahnte Durchhaltekräfte von Tausenden von Menschen frei. Sie wussten, wogegen sie waren. Sie wussten, wo sie hinwollten. Verschwommen blieb eine scheinbare aber wesentliche Rahmenbedingung. Doch dieses Bild stand in gegensätzlicher Spannung zur Erbschaft des Charakters des Nationalstaats aus dem 19. Jahrhundert als einem von mehreren Altlasten.
Während die 28 Staaten der Europäischen Union im Inneren damit ringen, tendenziell die Grenzen des Nationalen zu überwinden, um Europa im globalisierten Wirtschafts- und Finanzmarkt zu stärken, betrachtet der „Maidan“ seinen Weg nach Europa vorwiegend als nationalstaatlichen Denkschritt. Es ist der Wunsch nach nationaler Identität, nach Kompensation des Fehlens eines historischen ukrainischen Nationalstaates. Hier zeigt sich das Muttermal der früheren Herrschaft.
Nun sind es die Gegner des „Maidan“, die mit der nationalen Karte den Weg des „Maidan“ nach Europa blockieren wollen. Und es wirkt wie eine Farce, dass sich ausgerechnet einer von den wichtigen Orten der Beratungen der Anti-Hitler-Koalition auf der ehemals sowjetischen Krim befindet. Mit der neuen nationalen „Ordnung“ von Jalta des Jahres 1945 hatten die Alliierten die Einflusssphären in Europa aufgeteilt. Diese brachen erst 1989/1990 ein. Der „Geist“ von Jalta scheint dem „Maidan“ Steine in den Weg zu legen.
Entscheidend wird sein, wie sich die europäischen Gesellschaften öffnen, um bei der Europäisierung Europas voranzukommen. Der beschleunigte Abschied vom Nationalen fehlt auf dem „Maidan“. Und dennoch gibt dieses Manko fremden Militärs kein Recht, in verdrehter Verlängerung der Okkupations-Jahre 1956 (Budapest), 1968 (Prag) und 1979 (Kabul) im Land des „Maidan“ einzumarschieren.
Seit vielen Jahren verbreitet sich – ausgehend vom Krim-Konflikt – zum ersten Mal wieder Sorge um den Frieden in Europa. Mag auch ein militärisch-kriegerisches Szenario überzogen sein, so wird doch wenige Wochen vor den Europa-Wahlen die Bedeutung der Europäischen Union für den Erhalt einer nichtkriegerischen Interessensaushandlungskultur überdeutlich. Europa entfaltet grundsätzlich die Möglichkeit zur nichtmilitärischen Überwindung des Nationalstaatsdenkens. Jüngst erst hatte auch der Philosoph Jürgen Habermas eine Beschleunigung der Europäisierung und Demokratisierung des Kontinents gefordert.
Ernst Bloch hatte 1918 in seinem „Vademecum für heutige Demokraten“ gegen Ende des Ersten Weltkrieges warnend geschrieben: „Der Krieg selber kann gewiss nicht alles leisten. Durchaus nicht, er kann nur brechen, nicht bilden.“