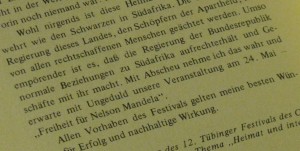Letzte Überlebende des französischen Widerstandes gegen Hitler erinnern in einer elsässischen Stadt 2015 an das Kriegsende 1945. (Foto: © Welf Schröter)
Ein Vierteljahrhundert nachdem die deutsch-deutsche Mauer durch demokratische Basisbewegungen von der Ostseite her endlich zum Einsturz gebracht wurde, regt sich in der bundesdeutschen Politik der rückwärtsgewandte Geist des Nationalen. Nicht marginale Gruppierungen am rechten Rand der Gesellschaft, nicht antieuropäische Tendenzen in politisch links stehenden Einzelströmungen geben Anlass zu prioritärer Sorge, sondern die Rückkehr des Nationalen in den Köpfen christdemokratischer Spitzenpolitiker inmitten der Bundesregierung provozieren das Gespenst des „hässlichen Deutschen“. Es offenbart sich ein Nationalismus des bürgerlichen Zentrums.
Die antieuropäischen Ausfälle reißen jene Vertrauensarbeiten ein, die zivilgesellschaftliche Akteure aus Deutschland gegenüber den Partnern in Frankreich, Polen, Rußland und Italien – um nur eine Auswahl zu nennen – in den letzten Jahrzehnten mühsam geschaffen haben.
Man muss dem früheren Außenminister Joschka Fischer Recht geben, der in einem scharfen Essay in der Süddeutschen Zeitung die katastrophalen Verfehlungen des Berliner Finanzministeriums angreift, das sich anheischig macht, Außenpolitik monokausal aus der Finanzpolitik abzuleiten. Mit spitzer Feder seziert Fischer:
„Die Frage, welchen Weg das wiedervereinigte Deutschland im 21. Jahrhundert einschlagen wird – hin zu einem europäischen Deutschland oder zu einem deutschen Europa –, ist mitnichten eine Frage von Pathos oder gar der politischen Romantik, sondern die sehr harte, realpolitische, ja historische Grundsatzfrage für alle deutsche Außenpolitik schlechthin.“
Der Grund hierfür liegt für Fischer in einer nüchternen Erkenntnis aus deutscher Geschichte:
„Die ,Macht der Mitte‘ sollte nie wieder zur Gefahr für den Kontinent und für sich selbst werden. (…) Mehr noch: Die wirtschaftliche Stärke der europäischen Zentralmacht sollte, in Verbindung mit der Aussöhnung mit dem alten ,Erbfeind‘ Frankreich, diese in einen gemeinsamen europäischen Markt mit der Perspektive einer dereinst stattfindenden politischen Einigung Europas bringen.“
Bitter fügte Fischer seiner Schrift gegen den Bundesfinanzminister und auf dessen politischen Verhalten am 13. Juli 2015 anspielend hinzu:
„Zum ersten Mal wollte Deutschland nicht mehr Europa, sondern weniger, und das heißt im Klartext: die Verwandlung der Euro-Zone von einem europäischen Projekt quasi in eine deutsche Einflusszone. Man könnte sagen, dies ist die spezifische Form von ,Renationalisierung im europäischen Gewande‘.“
Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Aufhebung der Blockgrenzen in Zentraleuropa, der Integration der früheren „Warschauer-Pakt-Staaten“ in die Europäische Union und mehr als ein Jahrzehnt nach Einführung des Euro als eine möglichst alle und alles verbindende gemeinsame Währung versucht ein Christdemokrat den Weg der Europäisierung Europas und der Europäisierung Deutschlands zurückzudrehen. Hätte dieser Mann doch vor 1989 in Leipzig, Prag oder Warschau gelebt, er würde heute das kostbare Leitbild Europa mit größter Vorsicht ansprechen. Doch der Mann ohne historisches Gedächtnis will wieder eine tonangebende deutsche Rolle in einem deutschen Europa.
Ein solches Ansinnen ist gefährlich, gefährlich für die europäischen Partnerinnen und Partner sowie auch gefährlich für die hiesige Zivilgesellschaft. Wer hätte gedacht, dass man im Jahr 2015 die Europapolitik des Christdemokraten Helmut Kohl gegen die Anti-Europapolitik des Christdemokraten Wolfgang Schäuble verteidigen muss. Würde sich Schäuble doch an die Mahnungen von Vaclav Havel, Richard von Weizsäcker, Władysław Bartoszewski und Jacques Delors erinnern. Sie erkannten den hohen Wert der politischen Idee von Europa und deren uneingeschränkter Dominanz über Markt und Finanzen.
Der „historische Bruch“ (Fischer) in der deutschen Europapolitik erfolgt im siebzigsten Jahr der von den Alliierten ermöglichten Befreiung vom Nationalsozialismus. Dieser „Bruch“ wäre leichter korrigierbar, wenn er nicht jene Latenz des Nationalen, jene Latenz deutscher Selbstüberhöhung und jene Latenz unabgegoltener Erbschaften berührte und in erneute Bewegtheit versetzte. Es ist den Zivilgesellschaften in Frankeich und in Italien zu danken, dass sie sich dem erneuten Streben nach deutscher Dominanz entgegenstellen.
Schon vor beinahe einhundert Jahren hatte sich Ernst Bloch in seinem Werk „Geist der Utopie“ (1919) der Idee Europas zugewandt. Er warnte vor „den Golems des europäischen Militarismus“ und in einer weitsichtigen Äußerung erkannte er die Gefahr, die dann zum Zweiten Weltkrieg führte. Er schrieb:
„Welches ist denn das Vaterland des wahrhaft ausgebildeten christlichen Europäers? Im Allgemeinen ist es Europa, insbesondere ist es in jedem Zeitalter derjenige Staat in Europa, der auf der Höhe der Kultur steht. Jener Staat, der gefährlich fehlgreift, wird mit der Zeit freilich untergehen, demnach aufhören, auf der Höhe der Kultur zu stehen.“
Die Gedanken der Re-Nationalen heute verhalten sich zur Gegenwart ungleichzeitig. Sie stehen mit dem Rücken zur europäischen Zukunft. Sie verweigern sich dem Noch-Nicht Europas und wenden sich ab vom gemeinsamen zivilgesellschaftlichen, solidarischen und vielfältigen Tagtraum eines ganzen Kontinents.